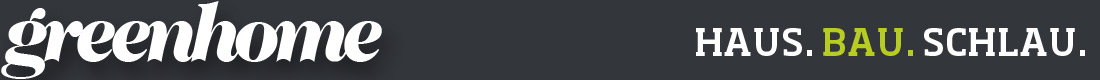Grüner leben in Berlin
 Verkehr, Lärm, Beton – für viele sind das die ersten Gedanken, wenn es um Großstädte wie Berlin geht. Doch in unserer Hauptstadt gedeiht eine Bewegung urbaner Gärtner, die viel Natur ins Herz der Metropole trägt.
Verkehr, Lärm, Beton – für viele sind das die ersten Gedanken, wenn es um Großstädte wie Berlin geht. Doch in unserer Hauptstadt gedeiht eine Bewegung urbaner Gärtner, die viel Natur ins Herz der Metropole trägt.
Berlin-Kreuzberg im Mai. Der Verkehr rauscht am Moritzplatz. Nach den knallkalten Eisheiligen ist es plötzlich hochsommerlich heiß geworden. Die Gräser auf der Verkehrsinsel stehen kerzengerade, so wenig Wind gibt es. Die Luft stinkt nach Abgasen. „Gutes Flugwetter für Bienen“, sagt Erika Mayr, Imkerin in Kreuzberg. Robinien, auch Scheinakazien genannt, blühen weiß, und Linden zeigen Blütenknötchen.
„Schade eigentlich, wenn die jetzt gleich blühen“, sagt die 38-jährige Gartenbauingenieurin, „dann gibt es in diesem Jahr nicht den typischen Frühlingshonig.“ Berlins bekannteste Imkerin produziert vier Geschmacksrichtungen Stadtbienenhonig. Während die Frühlingsvariante zart, mild und sehr flüssig ist, eben wie der Nektar der Robinien und der Frühlingsblüher, schmeckt der Sommerhonig kräftig, herb und vor allem wild. Eine Analyse wies über 500 verschiedene Pollen im Berliner Stadtbienenhonig nach. In ländlichen Regionen schafft er es meist nicht auf 60. Artenvielfalt ist hier das Stichwort und das ausgerechnet in Berlin?
Grüne Großstadt-Oasen
Am Moritzplatz befindet sich der Prinzessinnengarten. Ein „bienischer“ Katzensprung vom Dach des Künstlerhauses Aqua Carré, wo Erika Mayrs Bienen Honig produzieren. Während auf der ehemaligen Brache geplauscht, gejätet und gegraben wird, summen die Bienen in den Akazien. Die grüne Oase liegt an dem eher unwirtlich wirkenden Verkehrsknotenpunkt. Von hier zweigen sich Straßen voll innerstädtischen soziokulturellen Kunterbunts. Sozialbauten reihen sich an ehemals besetzten Altbaubestand, Bürogebäude stehen neben umfunktionierten Fabrikgebäuden und immer wieder dazwischen Brachen. Hier gibt es kleine Geschäfte, Buchläden, Döner, Bäcker, Discounter und alternative Stadtteilprojekte der Nachbarn.
Gerade dieses Mittendrin aber macht für die Imkerin den Charme berlinerischer Landwirtschaft aus. Wo kann man solche Gegensätze schon miteinander verbinden? 2008 begann sie mit ihrem ersten Bienenstamm, 20.000 Tiere, jetzt hat sie acht Stöcke. Eine richtige Landwirtschaft. Die Biene ist nach dem Rind und dem Schwein, das drittwertvollste Nutztier. Nur der Pollen, den eine Biene oder auch Hummel von einer zur anderen Blüte trägt, führt zu einer Frucht. 40.000 Blütenpflanzen könnten sich ohne die Honigbiene überhaupt nicht vermehren. Wenn es also keine Bienen mehr gibt, kommt jede landwirtschaftliche Produktion zum Erliegen. Auch in Berlin gäbe es also ohne Bestäubung keinen Apfel, keine Möhre, keine Gurke und auch nicht so viele Kräuter.
Gärtnern in der Metropole
 Den Prinzessinnengarten betritt man durch das Tor eines grünen Baustellenzauns. Aus Reissäcken ragen Tomaten- und Kartoffelpflanzen. Salatköpfe sprießen in mit schwarzer Erde gefüllten Plastikgitterkisten, Lavendel und andere Kräuter gedeihen in abgeschnittenen Tetrapacks. Eine Schülergruppe erhält Anschauungsunterricht im Gemeinschaftsgarten, aus einem umgebauten Bauwagen reicht eine Frau mit Piraten-Kopftuch das Tagesessen mit einem exotischen Namen. Außer dem Reis ist alles aus garteneigener Ernte.
Den Prinzessinnengarten betritt man durch das Tor eines grünen Baustellenzauns. Aus Reissäcken ragen Tomaten- und Kartoffelpflanzen. Salatköpfe sprießen in mit schwarzer Erde gefüllten Plastikgitterkisten, Lavendel und andere Kräuter gedeihen in abgeschnittenen Tetrapacks. Eine Schülergruppe erhält Anschauungsunterricht im Gemeinschaftsgarten, aus einem umgebauten Bauwagen reicht eine Frau mit Piraten-Kopftuch das Tagesessen mit einem exotischen Namen. Außer dem Reis ist alles aus garteneigener Ernte.
Es gibt eine Bibliothek in einem bunt bemalten Bauwagen, dort einen Zeitplan mit Workshops zum Imkern, Baumschneiden und dem Anlegen von Mischkulturen. „Nomadisch grün“ heißt die gemeinnützige GmbH, in deren Namen Robert Shaw und Marco Clausen 2009 den Prinzessinnengarten eröffneten. Nomadisch deshalb, weil sie, falls die Stadt den Pachtvertrag kündigt, die Beete jederzeit woandershin transportieren können. So flexibel ist städtische Landwirtschaft.
Erika Mayr fegt mit einem Reisigbesen vor der Szenebar „Mysliwka“, deren Teilbesitzerin sie ist, Zigarettenkippen aus den Lücken zwischen den Pflastersteinen. Es ist ein Donnerstag, ihr Bartag. Immer wieder schaut sie in Richtung Südwesten, dort, wo ungefähre fünf Flugkilometer entfernt, über die Hochbahn hinweg, die Schlesische Straße und das Kottbusser Tor, ihre Bienen Nektar, Pollen und Wasser in den Bienenstock tragen. Sie wirkt gespannt, wie auf dem Sprung. Jeden Moment kann ein Anruf kommen. Ein Bienenstock an der U-Bahn Brücke, an einem Baum vor einem Kaffee oder an einem Dachfirst. Selbst ins Abgeordnetenhaus wurde sie schon mal gerufen. Dann zieht sie los, mit ihrer Imkerkleidung, die immer ein wenig an Astronauten erinnert.
Mai ist eben Schwarmzeit. Und Bienen, denen es gut geht, die vermehren sich und können dann schon mal auf der Suche nach einem neuen Standort abhauen. „Eigentlich sollte ein Imker den Zeitpunkt erkennen, wann sich ein Volk trennen will und muss dann Platz zur Verfügung stellen“, sagt sie. Aber es passiert trotzdem, eben weil es diese unberechenbaren Momente in der Natur gibt. Wenn Bienen schwärmen ist das ein gutes Zeichen, denn dann vermehren sie sich. Die alte Königin macht Platz für jüngere. Sieht man also irgendwo eine summende Traube hängen, nicht in Panik geraten, sondern die Feuerwehr anrufen, die holen dann Leute wie Erika Mayr.
Gute Erträge in der City
 Dass sich die Bienen in der Stadt wohler fühlen als in deren brandenburgischem Umland, gehört zu den Merkwürdigkeiten unserer Zeit. Tatsache: Der Ertrag in der Stadt ist reicher als der auf dem Land, der Honig schmeckt vielfältiger und ist auch noch gesünder. Der Grund: Statt Hektare von pestizidbehandelten Monokulturen bietet die Hauptstadt eben allerhand gesunde Natur. 400.000 Bäume in Berlin, dazu Gräser und Blumen, Weingestrüppe, Efeu und Geißblatt an Fassaden, blühende Balkone und auch die Schrebergärten. Und dann kommen ja immer mehr ökologisch bewirtschaftete Stadtgärten hinzu. Aber was ist mit Staub und den Schadstoffen, die in der städtischen Luft nun mal nicht weggeredet werden können? Landen die nicht im Honig? „Nein“, sagt Erika Mayr. „Im Gegensatz zu den Pestiziden landen diese Schadstoffe eben nicht in den Nektarbeuteln, die sitzen nämlich tief und dann würde eher die Biene sterben, sie schwitzen sie im Wachs aus.“
Dass sich die Bienen in der Stadt wohler fühlen als in deren brandenburgischem Umland, gehört zu den Merkwürdigkeiten unserer Zeit. Tatsache: Der Ertrag in der Stadt ist reicher als der auf dem Land, der Honig schmeckt vielfältiger und ist auch noch gesünder. Der Grund: Statt Hektare von pestizidbehandelten Monokulturen bietet die Hauptstadt eben allerhand gesunde Natur. 400.000 Bäume in Berlin, dazu Gräser und Blumen, Weingestrüppe, Efeu und Geißblatt an Fassaden, blühende Balkone und auch die Schrebergärten. Und dann kommen ja immer mehr ökologisch bewirtschaftete Stadtgärten hinzu. Aber was ist mit Staub und den Schadstoffen, die in der städtischen Luft nun mal nicht weggeredet werden können? Landen die nicht im Honig? „Nein“, sagt Erika Mayr. „Im Gegensatz zu den Pestiziden landen diese Schadstoffe eben nicht in den Nektarbeuteln, die sitzen nämlich tief und dann würde eher die Biene sterben, sie schwitzen sie im Wachs aus.“
Solche Sachen erfährt man in Erika Mayrs jüngst bei Droemer-Knaur verlegtem Buch „Die Stadtbienen“. Das breite Wissen der in den Bergen Oberbayerns Aufgewachsenen Imkerin über Umwelt, Gartenbau und – natürlich – Bienen ist darin auf äußerst anregende und amüsante Weise mit der Geschichte einer Lebenssinnsuche verknüpft. „Lange war ich zwischen diesen Welten zerrissen. In Berlin vermisste ich die Natur und wenn ich auf dem Land war, das Leben in dieser Stadt.“ Es sind diese zunächst unvereinbar wirkenden Sehnsüchte, die eine ganze Generation erfasst zu haben scheinen. Man will in der Stadt leben, flexibel sein und sich doch irgendwie verwurzeln, es geht um Verantwortung und auch Lebensqualität. Die Initiatoren dieser Bewegung haben meist studiert und die Welt bereist.
Robert Shaw, zum Beispiel, einer der Gründer vom Prinzessinnengarten, brachte die Idee aus Kuba mit, wo er zwei Jahre lebte. Die Versorgungsnot hat die agricultura urbana auf der Insel längst zum politischen Programm gemacht. 90 Prozent des in Havanna und Santiago verzehrten Obstes und Gemüses stammen aus solchen städtischen Gartenproduktionen. In Berlin nennt man dieses Phänomen nach dem New Yorker Vorbild Urban Gardening. Und anders als in Kuba geht es in New York, Berlin und anderen europäischen Städten nicht in erster Linie um Versorgung, sondern um eine Lebensform.
Verschiedene Konzepte
Zwanzig Stadtgärten haben sich in Berlin bereits organisiert, weitere zehn sind in Planung. Unterschiede in den Gärten gibt es vor allem in der Aufteilung der Arbeit. Während auf dem ehemaligen Tempelhofer Flughafengelände jeder Nachbar ein oder mehrere Beete beackert, gärtnert man im Lichtenberger Stadtgarten nur gemeinsam. „Es gibt bei uns kein Eigentum“, sagt die 75-jährige Rentnerin Regine S. stolz, „alles wird gemeinsam gemacht.“ Sie schätzt dieses Gefühl von Gemeinschaft und eben den Kontakt zu den jungen Leuten. Der Stadtgarten Lichtenberg liegt in einer Plattenbausiedlung, die meisten Betreiber sind zwischen 30 und 40 Jahre alt und kommen mit dem Fahrrad aus den Szenekiezen Prenzlauer Berg und Friedrichshain.
Frische Ernte
 Gerade ist der Spinat geerntet, Natalie Fassmann kniet über der Erde, zupft Unkraut. Die promovierte Gartenbauingenieurin arbeitet als Redakteurin beim Bauern-Verlag, hat sechs Bücher mit Titeln wie „Mein Naschbalkon“ und „Auf gute Nachbarschaft. Mischkultur im Garten“ beim Eugen-Ulmer- und beim Pala Verlag veröffentlicht. „Spinat ist eine gute Frühkultur“, erklärt sie, „man kann ihn früh aussäen, so beschattet er den Boden, vermeidet dadurch Wasserverluste.“ Nach der Ernte nimmt sich jeder so viel er braucht. „Das finde ich so toll“, schwärmt Regine S., „es ist dieser bewusste Umgang mit den Lebensmitteln, auf den Tisch kommt eben, was der Garten gerade hergibt.“
Gerade ist der Spinat geerntet, Natalie Fassmann kniet über der Erde, zupft Unkraut. Die promovierte Gartenbauingenieurin arbeitet als Redakteurin beim Bauern-Verlag, hat sechs Bücher mit Titeln wie „Mein Naschbalkon“ und „Auf gute Nachbarschaft. Mischkultur im Garten“ beim Eugen-Ulmer- und beim Pala Verlag veröffentlicht. „Spinat ist eine gute Frühkultur“, erklärt sie, „man kann ihn früh aussäen, so beschattet er den Boden, vermeidet dadurch Wasserverluste.“ Nach der Ernte nimmt sich jeder so viel er braucht. „Das finde ich so toll“, schwärmt Regine S., „es ist dieser bewusste Umgang mit den Lebensmitteln, auf den Tisch kommt eben, was der Garten gerade hergibt.“
Nach dem Spinat pflanzen sie vorgezogene Kartoffeln und Rosenkohl auf die gejäteten Beete. Die Lichtenberger organisieren sich über die Internetseite www.stadtgarten.org. Dort diskutieren sie die Vereinssatzung, berichten, dass Bienen und ein Waschbär im Garten sind, notieren in einem Kalender, wer was wann gemacht hat. Sie unterscheiden Hardcore- und Flexifarmer. Erstere müssen mindestens fünf Wochenstunden investieren, die flexiblen, wie Regine kommen, wann sie Zeit haben.
Der hippe Schrebergarten
 Wer es dann doch etwas individueller will, dem bieten sich in Berlin ja noch Schrebergärten. Was bisher als kleinbürgerlich, spießig belächelt wurde, findet nun auch bei der städtischen Gärtner-Avantgarde immer mehr Zuspruch. Christoph Malkowski und Enrico Rima, beide 31, Jungunternehmer, beackern in der Kolonie Drosselgärten gemeinschaftlich eine solche Scholle. Klar, dass sie bei der Zucht von Tomaten, Radieschen, Kürbissen und Kräutern auf Artenvielfalt, Fruchtfolge und biologisches Saatgut achten. Aber auch hier ist es mehr als nur Hobby. Es ist eine Lebensweise. Man fährt kaum Auto, ernährt sich gesund und arbeitet ökologisch.
Wer es dann doch etwas individueller will, dem bieten sich in Berlin ja noch Schrebergärten. Was bisher als kleinbürgerlich, spießig belächelt wurde, findet nun auch bei der städtischen Gärtner-Avantgarde immer mehr Zuspruch. Christoph Malkowski und Enrico Rima, beide 31, Jungunternehmer, beackern in der Kolonie Drosselgärten gemeinschaftlich eine solche Scholle. Klar, dass sie bei der Zucht von Tomaten, Radieschen, Kürbissen und Kräutern auf Artenvielfalt, Fruchtfolge und biologisches Saatgut achten. Aber auch hier ist es mehr als nur Hobby. Es ist eine Lebensweise. Man fährt kaum Auto, ernährt sich gesund und arbeitet ökologisch.
Die Schulfreunde haben vor drei Jahren mit zwei weiteren Freunden „Lebenskleidung“ gegründet. Dieses in Kreuzberg sitzende Unternehmen bietet Bio-Textilien und -stoffe aus nachhaltigen Produktionen in Indien und der Türkei. Wenn es bei Christoph vor allem die Qualität der Lebensmittel ist, die ihn zum Schrebergarten brachte, ist es bei Enrico der perfekte Ausgleich zur Büroarbeit. „Im Garten sieht man das Resultat sofort“, sagt er, „und es ist eben auch sehr sozial.“ Wenn man den Nachbarn beim Baumbeschnitt hilft, zählt nicht, wie man sonst lebt und welche Partei man wählt. Das Thema seiner Magisterarbeit in seinem Studium Umweltwissenschaften hieß denn auch „Urban Gardening“.
„Es hat sich unglaublich schnell von einem nur Insidern bekannten Thema ins Zentrum des öffentlichen Interesses bewegt“, schreibt Enrico darin. Für ihn trifft der Begriff des „Re-Grounding“ die Sache am besten. Mit diesem Begriff benennen Wissenschaftler die soziale „Erdung“ und „Wieder-Verwurzelung“. Berlin bietet dafür einen äußerst nahrhaften Boden. Noch immer gibt es innerstädtisch ungenutzte Flächen. Man trifft auf Gleichgesinnte einerseits und schon existierende Strukturen andererseits. Die individuellen Sehnsüchte der Urban Farmer mögen vielfältig sein und doch haben sie eine große Gemeinsamkeit: Es geht um Wurzeln schlagen im globalen Zeitalter, ein zutiefst menschliches Bedürfnis nach Dazugehören.
Diesen Artikel verfasste Marion Müller-Roth für das greenhome Magazin
Fotos: Marion Müller-Roth